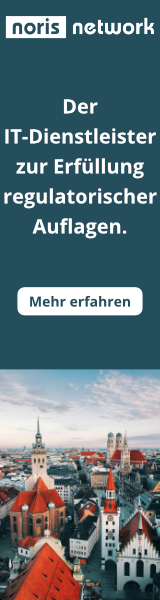Die Smart City verspricht Resourcenschonung, Energieeffizienz, stadtverträgliche Mobilität und direkte Bürgerbeteiligung. Zu Recht? Dieser Beitrag beleuchtet die Motive und Interessen hinter den Konzepten, richtet den Blick auf den Umgang mit Daten und plädiert für die demokratische Entwicklung der Städte.
Bis ins letzte Detail zu definieren, was eine Smart City genau ist, ist ebenso unmöglich wie unnötig. Die Ideen und Interessen, die hinter den unterschiedlichen Smart-City-Konzepten stecken, sind nicht immer deckungsgleich. Städte wie Wien beharren beispielsweise darauf, dass die sozialen Aspekte der Smart City besonders wichtig sind, andere heben speziell die Bürgerbeteiligung hervor.
Solche Beispiele ändern nichts daran, dass die Informations- und Kommunikationstechnik die DNA der Smart City ist und dass Geschäftsinteressen von Großkonzernen wie IBM, Cisco oder Siemens von Anfang an bestimmend waren. Ist es sinnvoll zu versuchen, das Konzept der Smart City im Sinne einer höheren Bürgerbeteiligung zu reformieren oder braucht es dafür alternative Ideen und Projekte, die neue und unabhängige Wege gehen?
Die Erfinder der Idee Smart City haben es sehr gut verstanden einen Entwurf vorzulegen, der viele aktuelle kommunale Problemfelder berücksichtigt und damit von Anfang an fast alle Player mit ins Boot holen können. Mit dem Thema Nachhaltigkeit wurden die gewöhnlich sehr kritischen Kämpfer für stärkeren Umweltschutz gewonnen. Liberale und Konservative begeisterten sich für die Mehr-Privat-weniger-Staat-Aspekte, also den Umstand, dass Private der Stadtpolitik nun endlich zeigen können, wie man Probleme im Bereich Mobilität und Ressourcenschonung angeht. Die EU konnte von Industrielobbyisten rasch überzeugt werden, dass eine Förderung von Smart-City-Projekten eine Win-Win-Situation ist, weil sowohl Arbeitsplätze geschaffen als auch ökologische Ziele erreicht werden können.
Stadtregierungen waren damit ebenso zu überzeugen und freuten sich zusätzlich über in Aussicht gestellte Fördergelder. Unternehmen selbst war klar, dass sich riesige Geschäftsfelder auftun, wenn Smart Cities zum Standard werden. Universitäten freuten sich über hohe Drittmittelforschungsgelder, worüber sich wiederum die Smart Cities-Befürworter freuten, weil damit potenzielle Kritiker ruhig gestellt werden konnten.
Kritisches Hinterfragen
Es lief und läuft im Sinne der Erfinder also eigentlich alles fast optimal. Nur fast deswegen, weil ab dem Zeitpunkt, als die Marketingmaschinerie für die ersten Vorzeigeprojekte anlief und damit klar wurde, was so eine Smart City wirklich werden soll, manche dann doch zu zweifeln begannen, ob sie die Stadt der Zukunft werden soll. Masdar City in Abu Dhabi war das Projekt, das damals (2010/2011) die höchste Aufmerksamkeit generierte und die war – zumindest zu Beginn – fast ausschließlich positiv. Die Idee einer Post-Oil-City mitten in einer der erdölreichsten Gegenden der Welt war tatsächlich zukunftsweisend. Es blieb natürlich nicht bei Masdar City. Mehr und mehr Smart-Citiy-Projekte und -Produkte wurden entwickelt und präsentiert. Damit stieg die Zahl derjenigen, die genauer hinsahen und sich nicht von Hochglanzbroschüren und tollen Websites blenden ließen.
Heute ist klar, dass ein sehr kritischer Blick unumgänglich ist, wenn es um die Beurteilung von Smart-City-Projekten geht. An zwei bekannten Beispielen kann leicht gezeigt werden, dass es schlussendlich in erster Linie um Profit und nicht um – wie in diesen beiden Fällen postuliert – Nachhaltigkeit oder eine stadtverträgliche Mobilität geht.
Eines der zentralen Argumente der Smart-City-Kampagne lautet, dass Städte unglaublich viel Energie verbrauchen und in Zeiten des Klimawandels dringend energiesparende Maßnahmen gesetzt werden müssen. Der Smart Meter war eines der ersten Produkte, das als großer Schritt im Kampf für Energieeinsparungen präsentiert wurde. Es soll hier gar nicht bestritten werden, dass der Smart Meter in manchen Situationen sinnvoll sein kann. Aber der flächendeckende EU-weite Austausch von analogen durch digitale Zähler ist eine Ressourcenverschwendung sondergleichen. Wie anders kann man es bezeichnen, wenn in Millionen Haushalten funktionierende Zähler, die noch viele Jahre ihren Dienst tun würden, durch Smart Meter ersetzt werden, die ziemlich sicher in nur wenigen Jahren wieder durch neue Modelle ersetzt werden müssen.
Die Energie, die in die Produktion und Montage von Smart Metern gesteckt werden muss, die Müllberge durch Millionen entsorgter Zähler und die Tatsache, dass die prognostizierten Stromersparnisse wohl ziemlich sicher nicht eintreten werden, müssten eigentlich klar machen, dass es sich beim Austausch zwar um ein tolles Geschäft, aber gewiss nicht um eine ökologisch nachhaltige Maßnahme handelt.
E-Fahrzeuge verschieben die Lösung
Ein zweites Beispiel ist die Elektromobilität. Es ist eine Tatsache, dass Stadtbewohner unter den Abgasen und dem Lärm von Verbrennungsmotoren leiden. Ebenso ist klar, dass der Flächenverbrauch einer autozentrierten Mobilität gerade in wachsenden Städten enorm ist. Lebenswerte Städte brauchen Mobilitätskonzepte, die die Straßen wieder zu lebendigen Orten machen und sie nicht einer monofunktionalen Nutzung opfern. Der Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotoren ist für dieses Problem nicht nur keine Lösung, sondern verschiebt eine mögliche Lösung noch weiter in die Zukunft. Somit wird das Andauern der durch Pkw verursachten eingeschränkten Lebensqualität in den Städten unnötigerweise verlängert.
Eine große Frage, die derzeit noch viel zu wenig diskutiert wird, richtet sich auf die Datennutzung. Wie kann gewährleistet werden, dass die von Stadtbewohnern produzierten Daten in erster Linie im Sinne einer bewohnerzentrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung verwendet werden anstatt vorrangig die Gewinne von Konzernen zu vergrößern?
Das zu Alphabet (Google) gehörende Unternehmen Sidewalk Labs schickt sich mit erheblichem Aufwand an, zum großen Player in allen Bereichen der Stadtentwicklung zu werden. Es ist also höchste Zeit, Gegenstrategien und unabhängige Strukturen zu schaffen, die die Hoheit über die Verwendung der Daten in die Hände der Städte legt. Ansätze dazu gibt es beispielsweise in Barcelona mit der Datenplattform City OS oder in EU-Programmen wie CAPS (Collective Awareness Platforms for Sustainabilitiy and Social Innovation).
Unsere Stadtgesellschaften brauchen dringend einen Demokratisierungsschub, um dem verbreiteten Frust über die politischen Verhältnisse etwas entgegenzusetzen. Bewohner dürfen von der Stadtpolitik nicht länger zu Konsumenten oder Bittstellern degradiert werden. Vielmehr müssen sie in ihrem Selbstverständnis als Stadtbürger gestärkt werden. Sie können und sollen selber mitreden, mitentscheiden und sich organisieren. Neue Technologien können dabei durchaus hilfreich sein. Smart Cities machen allerdings genau das Gegenteil. Sie fördern die passive Konsumentenhaltung und gefährden damit die demokratische Entwicklung unserer Städte.
Christoph Laimer
Der Autor
Christoph Laimer, Wien, ist Chefredakteur der Stadtforschungszeitschrift „Dérive“