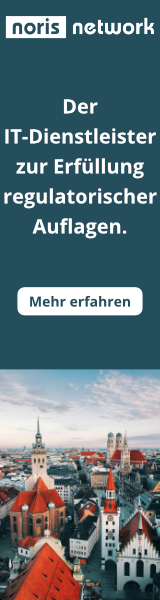Bereits erschlossene Flächen managen und für die Bebauung zu aktivieren, ist das Gebot der Stunde für Kommunen in der Innenentwicklung. Ein weiterer Schlüssel für klima- und ressourcenschonendes Bauen liegt in bestehenden Gebäuden: Sie müssen als „Rohstofflager der Zukunft“ betrachtet werden.
Nach wie vor wird in Deutschland zu viel Fläche verbraucht. Das betrifft besonders kleinere Städte und ländliche Räume, wo unentwegt vor allem Einfamilienhaus- oder Gewerbegebiete neu entstehen. Gleichzeitig fallen dort häufig die Ortskerne brach und veröden. Geht dies ungebremst weiter, verfehlt Deutschland nicht nur seine Flächenverbrauchs- und Klimaziele. Es verschwinden attraktive Ortsbilder und Kulturlandschaften und damit geht Heimat verloren.
Mit Blick auf die aktuelle Wohnungsnot gilt: Wir dürfen das Bauen nicht einstellen, sondern müssen es an den richtigen Orten und mit angemessener Gestaltung tun. Obwohl Wohnraum insbesondere in den boomenden Metropolregionen rar ist, fallen rund 80 Prozent des neuen Flächenverbrauchs auf kleinere Gemeinden in ländlichen Gebieten. Dabei stehen laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) noch bis zu 165 000 Hektar Fläche in integrierten Lagen für eine Ortsentwicklung zur Verfügung.
Eine sinnvolle und qualitätsvolle Innenentwicklung ist ein großer Hebel zur Umweltentlastung. Die vorhandene Infrastruktur zu nutzen, ist günstiger und umweltschonender, als Infrastruktur auszubauen. Nutzungsgemischte Quartiere, in denen zeitgemäße Grünkonzepte zur Erholung und Stadtklimatisierung mitgedacht werden, schaffen eine lebendige Umgebung.
Umweltprüfung nicht unterschlagen
Damit vorhandene Flächen entwickelt werden, ist ein vollständiger Überblick nötig. Flächenkataster sind hierfür ein gutes Instrument. Sie kartieren Baulücken, Industriebrachen und übergroße, wenig oder nur provisorisch bebaute Grundstücke. Auf Grundlage solcher Verzeichnisse können mittel- bis langfristig bestehende Flächen systematisch ausgeschöpft werden.
Davon müssen allerdings innenliegende Grünflächen oder gut erschlossene Lagen mit Außengebietscharakter ausgenommen bleiben, weil sie gerade bei einer zunehmenden Dichte für ihre Nachbarschaften Grünfunktionen übernehmen. Dies wird bei den erleichterten sogenannten Paragraf-13b-Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) häufig übersehen, bei denen eine Umweltprüfung bei geringer Flächengröße im Innenbereich unterbleiben kann. Diese Verfahren werden in kleineren Orten deshalb häufig missbraucht, um die letzte Obstwiese zu bebauen.
Trotz vorhandener Entwicklungsmöglichkeiten nutzen Eigentümer bestehende Baurechte oft nicht, sondern warten ab oder spekulieren auf eine Wertsteigerung ihres Bodens. Um dem entgegenzuwirken, können Kommunen Anreize für die Innenentwicklung schaffen oder gar ein Baugebot aussprechen. Beispielgebend sind in diesem Zusammenhang Orte wie Barnstorf in Niedersachsen, wo ein Grundsatzbeschluss für ein nachhaltiges Flächenmanagement gefasst wurde: Wohn- und Gewerbeflächen sollen nur noch durch Innenentwicklung, Flächenrecycling und Umnutzung gewonnen werden.
Die beste Möglichkeit zur Förderung der Innenentwicklung haben Städte aber, wenn sie selbst Grund und Boden besitzen. Sie können mit einer aktiven Ankaufspolitik vorausschauend planen und auf kurzfristige Bedarfe reagieren. Damit übernehmen sie Verantwortung für eine bessere Flächennutzung und Ortsgestaltung. Denn als Eigentümerin kann eine Gemeinde bei der Bereitstellung von Grundstücken großen Einfluss auf deren Bebauung ausüben. Durch die Vergabe der Grundstücke oder im Wege des Erbbaurechts können Kommunen zum Beispiel gute Nutzungsideen unterstützen. Im Rahmen von Konzeptvergaben können auch städtebauliche, soziale oder ökologische Aspekte Berücksichtigung finden.
Mehr Verantwortung für Kommunen
Ein weiterer Schlüssel für klima- und ressourcenschonendes Bauen liegt in bestehenden Gebäuden: Sie müssen künftig als „Rohstofflager der Zukunft“ betrachtet werden. Die hier gebundene „graue Energie“ spricht häufig gegen den Abriss. Bereits verbaute Materialien sollten weitergenutzt werden, um die Menge an benötigten Primärrohstoffen zu verringern. Neu ist diese Idee nicht. Bis ins frühe 20. Jahrhundert wurde Baumaterial aus zerstörten Gebäuden selbstverständlich wiederverwendet. Bei Neubauten lassen sich durch komplexe Verbundverfahren viele Baustoffe nicht mehr in ihre Ausgangsstoffe zerlegen. Und auch die Schadstoffinhalte eines neuen Produkts werden immer noch nicht ausreichend bewertet.
Wo traditionelle Baustoffe zum Einsatz kommen, profitieren auch die Städte. Sie erhalten sich ihre lokale Identität, ihre Unverwechselbarkeit und ihren Charakter. So sammelt und lagert die Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg schon seit Anfang der 1990er-Jahre im Rahmen eines nicht-kommerziellen Projektes historische Baustoffe, Fenster und Türen und vermittelt diese auf Antrag an geeignete Sanierungsvorhaben. Solche Ansätze müssen an Bedeutung gewinnen und sich auf dem breiten Absatzmarkt etablieren, da sie in besonderem Maße die baukulturelle Wertschätzung mit der ökologisch sinnvollen Kreislaufwirtschaft verbinden.
Durch ihre kommunale Planungshoheit können Gemeinden steuern, wie Gebäude, Straßenzüge, Plätze und Viertel aussehen sollen. Die Kommunalumfrage zum Baukulturbericht 2016/17 hat ergeben, dass nur sehr wenige Kommunen in Deutschland diese Gestaltungsmöglichkeit wahrnehmen. Nur neun Prozent der Befragten gaben an, eine städtebauliche Rahmenplanung selbst zu erstellen und nur drei Prozent erarbeiten noch selbst die Bebauungspläne.
Es wäre ein wichtiger Schritt, wenn Kommunen auch auf konzeptioneller Ebene wieder mehr Verantwortung übernähmen, damit die Bestandsentwicklung an Qualität gewinnt. Auch Gestaltungsbeiräte tragen mit ihrer fachlichen Kompetenz ebenfalls zu einer erkennbar höheren Qualität von Projekten bei. Oder die Auslobung von Wettbewerben mit begleitender öffentlicher Diskussion befördern die Baukultur.
Viele Kommunen schaffen es auf diese Weise, sich mit vorausschauenden Ideen für das Ortsbild und das Zusammenleben erfolgreich weiterzuentwickeln. Iphofen (Bayern) gilt als ein gutes Beispiel. Die kleine, 4600 Einwohner zählende Stadt hat Regeln und Förderanreize geschaffen, um das Zentrum attraktiv und lebendig zu gestalten, und dadurch seinen Charakter kontinuierlich gestärkt. Dazu gehört eine Gestaltungssatzung, die die kleinteilige Bebauungsstruktur wahrt und Neubauten einen klaren Rahmen vorgibt, ohne interessante Architektur zu verhindern. Gleichzeitig werden Bauherren, die Altbauten sanieren oder umbauen, kostenlos von der Stadt beraten und können Fördergelder erhalten. So haben die Bewohner der Altstadt nicht mehr Aufwand als Bauherren in Neubaugebieten.
Reiner Nagel
Der Autor
Reiner Nagel ist Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur