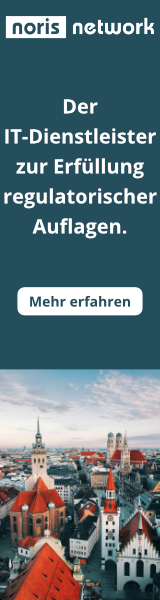Anke und Daniel Domscheit-Berg aus Fürstenberg an der Havel wollen mit einem neuen Geschäftsmodell den Glasfaser-Markt aufrollen. Im Interview benennen sie die Hürden für einen hochleistungsfähigen Breitbandausbau und erläutern den Ansatz ihres Start-up-Unternehmens Viaeuropa Deutschland.
der gemeinderat: Frau Domscheit-Berg, Herr Domscheit-Berg, Deutschland als eine der international wirtschaftsstärksten Nationen lässt sich beim Aufbau schneller Datennetze von anderen Ländern abhängen. Was läuft Ihrer Meinung nach falsch?
Anke Domscheit-Berg: Wir verschlafen notwendige Investitionen mit einer soliden Zukunftsperspektive schon seit Jahrzehnten und sind an einem Punkt angelangt, an dem die Auswirkungen dieser Fehlplanung drastisch spürbar werden. So ist Deutschland in Europa inzwischen auf dem vorletzten Platz beim Anteil von Glasfaser an Breitbandanschlüssen (nur Griechenland ist noch schlechter) und auch im globalen Innovationsranking sind wir Absteiger. Deutschland fehlt eine realistische und kluge Strategie für einen flächendeckenden Ausbau. Die einzige Strategie, die wir zu haben scheinen, sind staatliche Subventionen für ein monopolistisches Unternehmen, das den Ausbau fast allein umsetzen soll, obwohl genau dieses Unternehmen den Ausbau versäumt hat und selbst zugibt, dass es den Ausbau zeitnah gar nicht leisten kann.
der gemeinderat: Sie sprechen von der Deutschen Telekom …
Daniel Domscheit-Berg: Vergleichen wir einfach den Telekommunikationsmarkt mit der Verkehr- und Autoindustrie. MIt der Deutschen Telekom existiert heute ein Unternehmen, das sowohl Autos baut (Telekommunikationsdienste anbietet), als auch einen Großteil der Straßen besitzt (Telekommunikationsnetze) – vom Feldweg bis zur Autobahn. Stellen wir uns vor, es gäbe in Deutschland ein paar Autobahnen zwischen den Großstädten, aber sonst vor allem ein Netz von Feldwegen. Wer käme auf die Idee, VW damit zu beauftragen, in wenigen Jahren alle Feldwege in asphaltierte Straßen auszubauen?
der gemeinderat: Worauf wollen Sie hinaus?
Daniel Domscheit-Berg: Genau das ist die Strategie der Bundesregierung! Sie reicht Milliarden Euro an die Deutsche Telekom, die damit aber nicht etwa Glasfaser zur Haustür bringt, also „asphaltierte Schnellstraßen“ für ein zukunftssicheres Netz baut, sondern stattdessen das Geld in die „Ertüchtigung von Feldwegen“ steckt, damit alle etwas schneller über die Feldwege fahren können. Genau das passiert mit Vectoring.
der gemeinderat: Was kritisieren Sie am Vectoring-Verfahren?
Daniel Domscheit-Berg: Wie bei geflickten Feldwegen, wo die Schlaglöcher wieder durchkommen, ist auch das in Vectoring gesteckte Geld keine nachhaltige Investition, weil diese Technologie der Datennachfrage schon jetzt nicht genügt – erst recht nicht in Zukunft. Es ist verbranntes Geld für eine bereits veraltete Technologie, keine Investition in eine Zukunftsinfrastruktur. In der Welt der Verkehrswege haben wir längst verstanden, dass Autobauer nicht Straßenbauer sein sollten und dass geflickte Feldwege keine Zukunftsinfrastruktur darstellen. Für die Datenautobahnen ist diese Erkenntnis leider noch nicht sehr verbreitet.
der gemeinderat: Wer trägt aus Ihrer Sicht die Verantwortung für die Situation?
Anke Domscheit-Berg: Die Verantwortung tragen vor allem die Deutsche Telekom und Entscheider in der Politik – mit allen personellen Überschneidungen, die es da so gibt. Die Bundesregierung ist der größte Einzelaktionär der Deutschen Telekom, und das Unternehmen beschäftigt aus historischen Gründen noch sehr viele Beamte. Wir wissen daher nicht, ob die Telekom einfach nur durch guten Lobbyismus die Politik für dumm verkauft, ob die Interessen des Finanzministers als Aktionär hier die entscheidende Rolle spielen, oder ob in der politischen Landschaft wirklich so wenig angekommen ist, wie wichtig richtiges Breitband für unser Land ist. Das erklärte strategische Ziel der Deutschen Telekom ist jedenfalls, die Oberhand über die Netze zu behalten, verbunden mit der Absicht, aus dem alten Telefonnetz noch einen maximalen Profit herauszuholen. Die Konsequenzen sind fatal und es wird Zeit, diesem Irrsinn ein Ende zu bereiten.
der gemeinderat: Glasfaserausbau gerade in ländlichen Räumen ist zu teuer und daher flächendeckend nicht machbar, heißt es immer wieder. Wie schätzen Sie diese Frage ein?
Daniel Domscheit-Berg: Der Glasfaserausbau ist natürlich immer dann teurer, wenn es um dünn besiedelte Gebiete geht. Wobei ja nicht die Kosten das Problem sind, sondern die Profitabilität. Die Frage ist allerdings, welcher Profit anfällt und für wen. Für ein kommerziell operierendes Unternehmen ist ein schneller, flächendeckender Ausbau bis in das letzte Dorf illusorisch. Also wird wenn, dann nur dort ausgebaut, wo es gute Aussichten auf sowohl schnelle als auch hohe Profite gibt.
der gemeinderat: Wie sieht die Rechnung mit der Profitabilität aus, wenn eine Kommune oder ein Landkreis den Ausbau selbst vornehmen?
Anke Domscheit-Berg: Dann geht es einerseits um überschaubare Investitionen und andererseits weder primär um schnelle Renditen noch nur um rein monetäre Mehrwerte. Als Netzeigentümer erhalten Kommunen langfristig direkte Einkünfte durch eine feste und hohe Beteiligung an den Internetentgelten jedes Haushaltes, der diese Leistung nutzt. Damit refinanziert sich die Investition in einem überschaubaren Zeitrahmen. Darüber hinaus entsteht aber auch ein breitgefächerter Zusatznutzen durch das zukunftssichere Netz, das die Attraktivität des Standorts erhöht und künftig sichert. Das schnelle Netz wird zur Lebensader für Kommunen. Es entstehen neue Arbeitsplätze und Perspektiven für die Einwohner und Steuereinnahmen steigen. Die Nutzenrechnung ist hier also eine andere.
der gemeinderat: Muss der Staat mehr Geld in die Hand nehmen, damit Deutschland schnell zur Gigabit-Nation wird?
Anke Domscheit-Berg: Das Geld darf vor allem nicht heute in Technologien investiert werden, die jetzt schon veraltet sind und in wenigen Jahren massive Neuinvestitionen in eine echte Zukunftsinfrastruktur nach sich ziehen. Vectoring ist die Braunkohle der Kommunikationstechnologie, dafür sollte man keine Milliarden Steuergelder verbrennen. Ohne Zweifel ist nur ein ausschließlicher Glasfaserausbau eine kluge Strategie auf dem Weg zur Gigabit-Nation, da nur Glasfaser auch Gigabit-Geschwindigkeiten liefern kann. Schweden, in Europa das erfolgreichste Land beim Ausbau von Glasfasernetzen, hat viel weniger staatliche Fördergelder investiert und hat es trotzdem geschafft.
der gemeinderat: Sie treten mit einem neuen Unternehmen an, den Glasfaserausbau in Deutschland voranzutreiben …
Daniel Domscheit-Berg: Wir wollen das schwedische Erfolgsmodell nach Deutschland importieren. In Schweden sind heute etwa zwei Drittel aller Kommunen Eigentümer ihrer eigenen Glasfasernetze, und da wollen wir auch hin. Die Grundlage dafür ist eine Aufteilung der Wertschöpfungskette, damit endlich auch in der Kommunikationsinfrastruktur Netze und Diensteanbieter voneinander getrennt werden. Die Trennung der einzelnen Schichten voneinander verhindert auch Interessenskonflikte.
der gemeinderat: Wie sieht Ihr Modell aus?
Anke Domscheit-Berg: Am Anfang dieser Wertschöpfungskette steht das Verbuddeln der Glasfaserkabel, die sogenannte passive Infrastruktur. Dazu braucht es einen Tiefbauer und Kenntnisse zu Regulierungen, Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren. Alles das ist in Kommunen bestens angesiedelt. Die nächste Ebene ist der Betrieb der aktiven Infrastruktur, Router und Switches, mit dem das Glasfasernetz sozusagen „beleuchtet“ und für eine unterbrechungsfreie Übertragung gesorgt wird. Das übernimmt ein spezialisierter Netzbetreiber. Im schwedischen Modell kommt als oberste Schicht der virtuelle offene Marktplatz, auf dem verschiedene Diensteanbieter transparent für alle Nutzer ihre Angebote präsentieren, vom Internet mit bestimmten Geschwindigkeiten über Telefonie bis hin zu Mehrwertdiensten wie Videoangeboten. Dort können Verbraucher mit wenigen Klicks jederzeit ihr genutztes Angebot oder den Anbieter auch wechseln, ohne jahrelange Kündigungsfristen, wie wir das aus Deutschland kennen. Dieser Marktplatz ist der Beitrag von Viaeuropa in diesem Geschäftsmodell. Das Ergebnis ist ein win-win für alle Beteiligten, bisherige Monopolisten ausgenommen: schnelles, preiswertes Internet für private, wirtschaftliche und behördliche Nutzer sowie Marktpotenziale für kleine, mittlere und große Unternehmen.
der gemeinderat: Welche Erfahrungen liegen mit dem Modell vor?
Daniel Domscheit-Berg: Seit Ende der 90er-Jahre wird dieses Modell in Schweden eingesetzt. Unser (Mit-) Gesellschafter und Partner Viaeuropa Sveridge hat es erfunden, wonach es zum quasi Standard für den Breitbandausbau in Schweden wurde. Die Mehrheit der schwedischen Kommunen praktiziert das Modell. Nun wird es auch in anderen Ländern umgesetzt, zum Beispiel in Großbritannien, Costa Rica und Israel. Gerade startet auch ein Pilot in Österreich.
der gemeinderat: Ihr Unternehmen selbst baut keine Glasfasernetze, diese Rolle sollen die Kommunen übernehmen. Was genau wird von ihnen erwartet?
Anke Domscheit-Berg: Die Kommunen sollten diese kritische Infrastruktur als ihr Eigentum aufbauen und im Rahmen der Daseinsvorsorge zu solchen Rahmenbedingungen bereitstellen, dass im Ergebnis der Nutzen für die Bürger der Kommune maximiert wird: ultraschnelles Internet für alle zu möglichst niedrigen Preisen. Dazu müssen Kommunen wissen, welche nutzbaren Netze vorhanden sind, eine Marktabfrage vornehmen, ob ein Unternehmen den Ausbau eines Glasfasernetzes bereits plant und falls nicht, die Verlegung der passiven Infrastruktur ausschreiben und vergeben. Ist das Netz erst einmal ausgebaut, schreibt die Kommune den Betrieb des Netzes aus – mit der Vorgabe, dass die Nutzung der Netzleistung zu neutralen Konditionen über einen virtuellen Marktplatz allen interessierten Diensteanbietern zur Verfügung gestellt werden muss. Ist das Netz in Betrieb, erhält die Kommune von den Betreibern des virtuellen Marktplatzes monatliche Berichte, auf deren Basis die Kommune Rechnungen stellen kann, um vom Marktplatzbetreiber ihren Anteil an den Internetgrundentgelten zu erhalten. Die Kommune wiederum reicht einen Teil davon weiter an den Netzbetreiber für dessen Leistungen.
der gemeinderat: Wie finanziert sich der kommunale Glasfaserausbau nach Ihrem Ansatz?
Daniel Domscheit-Berg: Pro anzuschließenden Haushalt ist mit durchschnittlich 2000 bis 2500 Euro Anschlusskosten zu rechnen. Es gibt etwa KfW-Kredite für Kommunen, die zwei Jahre tilgungsfrei sind und für die danach auch nur 0,4 Prozent Zinsen anfallen. In den tilgungsfreien Jahren können die ersten Netz-Ausbauviertel, die Fiberhoods, fertig erschlossen sein, sodass dann auch schon monatlich Geld von den Nutzern des Internets an die Kommune zurückfließt. Von den Grundentgelten für alle Internetprodukte erhält die Kommune als Eigentümerin der Glasfaserinfrastruktur 50 Prozent. Etwa 30 Jahre lang ist die passive Glasfaserinfrastruktur weitgehend wartungsfrei, verursacht also auch kaum neue Kosten.
der gemeinderat: Mit welchen Amortisationszeiträumen ist nach bisheriger Erfahrung zu rechnen?
Daniel Domscheit-Berg: In Schweden nutzt man verschiedene Geschäftsmodelle mit unterschiedlich langen Refinanzierungszeiträumen. Manche Städte lassen sich von Eigenheimen und Gewerben 2000 Euro Anschlusskosten einmalig bezahlen und haben dann den jeweiligen Haushaltsanschluss in weniger als drei Monaten refinanziert – der Rest der 30 Jahre Laufzeit ist Reingewinn. Andere Städte lassen sich nur einen Teil der Anschlusskosten bezahlen. Für Deutschland ist wohl ein weiteres Modell passender, bei dem die Bürger keine nennenswerten Anschlusskosten tragen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zur Infrastruktur der Zukunft zu ermöglichen. Dann dauert die Refinanzierung etwa acht bis 13 Jahre – je nach Ausgangslage, Eigenmitteln, Kredit- und Zinshöhe sowie spezifischen Ausbaukosten.
der gemeinderat: Ist Ihr Modell geeignet, FTTB/FTTH auch in Gegenden mit geringer Einwohnerdichte und wenigen Unternehmen zu bringen?
Daniel Domscheit-Berg: Die Einwohnerdichte in Schweden liegt über das Land verteilt bei 22 Einwohnern pro Quadratkilometer. In Deutschland beträgt dieser Wert 230. Ländliche Gegenden sind aber oft weniger versiegelt, sodass die Erschließung gleicher Distanzen oft einfacher und damit preiswerter zu erledigen ist – Glasfaser am Ackerrand ist um ein Vielfaches billiger zu verlegen als unter einem Gehweg in einer Stadt. Andererseits sind die Distanzen zwischen Haushalten und zum nächsten Internet-Uplink oft insgesamt höher. Ganz pauschal lässt sich die Frage daher nicht beantworten. In Schweden gibt es auf jeden Fall auch abgelegene und sehr dünn besiedelte Gebiete, die mit Glasfaser versorgt werden. So zum Beispiel die Region Skellefteå im Nordosten mit einer Bevölkerungsdichte von sieben Einwohnern je Quadratkilometer. Für Gegenden, die sehr abgelegen und ganz besonders dünn besiedelt sind, hat die schwedische Regierung ein Subventionsprogramm aufgelegt, um die Finanzierung zu erleichtern. Es gibt dort außerdem häufiger zivilgesellschaftliche Initiativen wie Genossenschaften, die gemeinsam das örtliche Glasfasernetz aufbauen.
Interview: Wolfram Markus
Zur Person: Anke Domscheit-Berg ist Netzaktivistin und Publizistin vor allem zu den Themen Open Government, Digitale Gesellschaft und Geschlechtergerechtigkeit; sie blickt auf 15 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie zurück (anke@domscheit-berg.de). Daniel Domscheit-Berg ist Netzwerkingenieur und Internetaktivist. Er arbeitete für Großunternehmen und beschäftigte sich vor allem mit dem Aufbau sicherer Netzwerke