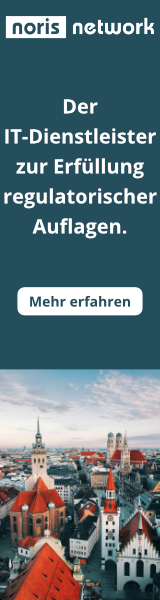Anspruch und Wirklichkeit klaffen beim Thema Wärmewende weit auseinander. Gerade Kommunen sollten ein Interesse daran haben, diese Lücke zu schließen. Denn über den Klimaschutz hinaus bedeuten nachhaltige Konzepte der Wärmeversorgung auch einen Zugewinn an Attraktivität für Regionen.
Die erfolgreiche Wärmewende ist kein Selbstläufer!“, schreibt die Agentur für Erneuerbare Energien Ende 2016 in ihrer Kurzstudie „Die neue Wärmewelt“. Tatsächlich stagniert der Ausbau regenerativer Wärme seit 2010 bei einem Anteil zwischen 11 und 13 Prozent des gesamten Wärmebedarfs. Im Stromsektor dagegen wurde ein kontinuierlicher Anstieg des Anteils regenerativer Energie von 17 auf rund 36 Prozent erreicht.
Gleichzeitig steigen die Kosten der fossilen Wärmebereitstellung. War noch vor 15 Jahren der Richtpreis der OPEC pro Barrel Rohöl bei etwa 30 Dollar, so hat sich der Ölpreis bis heute mehr als verdoppelt. Die Preissteigerung im Wärmebereich insgesamt ist höher als im Strombereich und im Geldbeutel der Bürger unmittelbar spürbar. Dies wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft vergessen.
Es gibt noch sehr viel zu tun
Aber Politik, Wirtschaft und Forschung schenken der Wärmewende wachsende Beachtung: Bundesländer bauen landesweite Wärmekataster auf, erarbeiten Strategien für die Wärmewende oder fördern den Wärmesektor mit speziellen Programmen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert vor dem Hintergrund einer von ihm in Auftrag gegebenen Studie eine deutlich größeres Engagement im Bereich der Gebäudesanierung sowie den Ausbau von Wärmenetzen mit regenerativer Wärmeerzeugung. Diesen unterstützt derzeit auch schon die Bundesregierung mit dem Programm Wärmenetze 4.0. Auch die Industrie, so heißt es beim Verband, müsse ihren Wärmebedarf deutlich reduzieren. Die besagte BDI-Studie von Anfang 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass der Gebäudebereich bis 2050 CO2-neutral sein müsste, um das Ziel einer 95-prozentigen Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 zu erreichen.
Die Forschung geht in großen Modellierungen zur Abschätzung der künftigen Energieversorgungsoptionen davon aus, dass bis 2050 keine fossilen Energieträger wie Heizöl mehr zur Wärmeversorgung eingesetzt werden. Eine wichtige Maßnahme zur Zielerreichung sei dabei unter anderem die Suffizienz, das heißt der maßvolle Umgang mit Ressourcen. So sollten zum Beispiel die Wohnfläche pro Kopf wieder zurückgehen, neue Wohnformen könnten etabliert werden. Neue Investitionen in mit Heizöl befeuerte Heizungen sollten vermieden werden, um die Wärmewende zu unterstützen.
Jeder kann machen wie er will
Anspruch und Wirklichkeit der Umsetzung der Wärmewende liegen ungeachtet der Aktualität des Themas noch weit auseinander. Dies hat einen einfachen Grund: Wärme wird im Gegensatz zu Strom regional oder meist gar lokal, im eigenen Haus, produziert. Jeder Hausbesitzer, jeder Fabrikant, jeder Bürgermeister kann bei der Wärmeversorgung selbst entscheiden, wie er auf Grund ökonomischer Gegebenheiten oder aber klimaschutzfachlicher Überlegungen die benötigte Wärme oder Prozessenergie erzeugt und wie er sein Gebäude dämmt.
Einflussmöglichkeiten des Staates auf Individualentscheidungen sind hier generell gering oder werden nicht immer in Erwägung gezogen. Eine CO2-Bepreisung (z. B. durch eine Besteuerung oder eine Verknappung von Zertifikaten) ist momentan zwar in Diskussion, aber noch lange nicht umgesetzt. Bundes- oder Länderförderungen zur Wärmewende gibt es in vielfältiger Art, sie sind jedoch nicht ausreichend finanziert für die Mammutaufgabe der Dekarbonisierung des Wärmesektors.
Die Energieeinsparverordnung (ENEV) als Beispiel normativer Regelungen brachte zwar durch ambitionierte Energierichtwerte im Neubaubereich eine große Reduktion des Raumwärmebedarfs pro Kopf von durchschnittlich 200 auf 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr in den letzten 20 Jahren. Allerdings ist gleichzeitig die Wohnfläche pro Kopf gestiegen, sodass sich der Raumwärmebedarf insgesamt wenig verändert hat (Rebound-Effekt).
Möglichkeiten der Kommunen
Kommunen haben verschiedene Möglichkeiten, die Wärmewende zu gestalten. Spezifische Quartierskonzepte, baurechtliche Vorgaben, Maßnahmen der Akzeptanzsteigerung sind Beispiele hierfür. In den letzten zehn Jahren hat sich einiges getan. So gibt es viele gelungene Beispiele von Klimaschutzkommunen und Bioenergiedörfern. Die Bundesregierung hat im Rahmen der Klimaschutzinitiative 25 000 kommunale Projekte gefördert, ein großer Teil davon im Wärmesektor. Klimaschutzmanager oder Energiebeauftragte treiben in vielen Städten und Gemeinden die Energiewende voran.
Diese einzelnen Maßnahmen sind wichtig. Jedoch zeigen die Ergebnisse mehrerer Forschungsarbeiten, dass die Energiewende und damit auch die Wärmewende für die Kommunen noch immer nicht verbindlich genug sind. So wird die Energiewende vielfach nicht als Teil der Daseinsvorsorge verstanden. Dementsprechend konstatieren Klimaschutzmanager, dass sie nicht an den „Brottöpfen“ der Gemeinde mit entsprechenden Entscheidungsbefugnissen sitzen. Die Einsicht in die Notwendigkeit langfristiger Planungen gerade im Wärmesektor fehlt bei den Bauämtern und die knappe Personalausstattung erschwert ganzheitliche kommunale Konzepte der Energieversorgung.
Dabei bedarf es gerade im Wärmesektor einer langfristigen, nachhaltigen Planung. Eine Studie des Saarbrücker Instituts für Zukunftsenergie- und Stoffstromsysteme (IZES) in der Region Trier Eifel zeigte 2017, dass jedes Dorf und jeder Stadtteil unterschiedliche Voraussetzungen zur Umsetzung der Wärmewende aufweist. Einige Quartiere könnten durch solare (niederkalorische) Wärmenetze versorgt werden, bessere Wohnlagen mit jüngerer Bausubstanz ließen sich zu Passivhausquartieren entwickeln.
Bei einer schlechten Bausubstanz in einer schlechten Wohnlage dagegen ist nicht zu erwarten, dass in absehbarer Zeit in eine vollumfängliche energetische Sanierung investiert wird. Hier könnte ein herkömmliches Wärmenetz oder ein Siedlungsrückbau in Erwägung gezogen werden. Das Wärmekataster des Saarlandes etwa zeigt, dass dieses Kriterium für mehr als 20 Prozent der Quartiere im Land zutrifft. Ein solches Wärmekataster bietet übrigens eine gute Grundlage für die Planung künftiger Wärmeinfrastrukturen, von Schwerpunktgebieten der energetischen Sanierung oder für das Erarbeiten spezifischer Förderungen.
Gesamtheitliche Planung ist wichtig
Die IZES-Studie zeigt auch, dass Biomasse für die Wärmeerzeugung im Wohngebäudebereich sparsam eingesetzt werden sollte. Denn unter Umständen ist es besser, in einem in der Nachbarschaft liegenden Gewerbe- oder Industriegebiet Biomasse zur Erzeugung von hochkalorischer Wärme einzusetzen und dann mit industrieller Abwärme Wohnsiedlungen zu versorgen. Es ergäben sich positive Effekte auch für die Beschäftigung in der Region, wenn durch eine zentrale Wärmeversorgung der Industrie mit Biomasse Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden.
Diese Beispiele zeigen die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Planung und (inter-)kommunalen Strategie für den Wärmebereich – beides in Deutschland noch nicht an der Tagesordnung, im Gegensatz zu Ländern wie zum Beispiel Dänemark. Dabei bieten sich viele Möglichkeiten. So könnten beispielsweise personell besser ausgestattete Rathäuser oder Kreisverwaltungen Planungsarbeiten für andere Kommunen übernehmen, Regionen könnten sich den Wettbewerb teilen und mit dekarbonisierten Gewerbe- und Industriegebieten werben. Dies wird bei einer zu erwartenden Steigerung der CO2-Preise zu einem großen Standortvorteil.
Auch Bioenergiedörfer können, wie viele Beispiele zeigen, ein Aktivposten im Wettbewerb zwischen Regionen um neue Mitbewohner sein. Bei Hausverkäufen wird in solchen Kommunen heute schon vielfach mit dem Label „Bioenergiedorf“ geworben.
Bernhard Wern
Der Autor
Bernhard Wern ist Leiter des Arbeitsfeldes Stoffströme beim Institut für Zukunftsenergie- und Stoffstromsysteme (IZES) in Saarbrücken