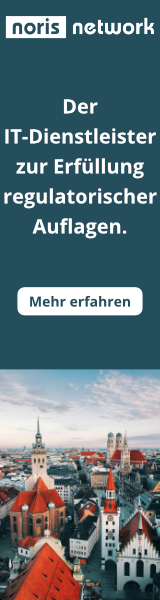Die Debatte um Lärm ist immer auch eine Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Umwelt. Es geht um Teilhabe und Artikulation von Interessen. Das lehrt der Blick in die Entwicklung urbaner Klanglandschaften. Um mitreden zu können, brauchen kommunale Entscheidungsträger ein akustisches Bewusstsein.
Nach einer Schätzung des kanadischen Akustikforschers Murray R. Schafer setzte sich die industrielle Lautsphäre des 19. Jahrhunderts nur mehr zu einem Drittel aus Natur- und Menschenlauten und zu zwei Drittel aus Werkzeug- und Maschinengeräuschen zusammen. Es waren insbesondere die akustischen Profile der Fabriken und der neuen Verkehrsmittel Eisenbahn, Straßenbahn und Automobil, die sich rasch als Leitgeräusche der Moderne etablierten. Vor allem in den Metropolen bildete sich ein typischer „Großstadtwirbel“ heraus, mit überdichten, sich ständig überlagernden Signalen und Geräuschen.
Die gegen Ende des Jahrhunderts sich beschleunigende Urbanisierung führte zu einem großflächigen Ausbau der technischen Infrastruktur und einer zunehmenden Verdichtung des öffentlichen Raumes. Von akustischer Seite ist insbesondere die Versiegelung des Untergrundes und das Anwachsen der geschlossenen Verbauung von Bedeutung – in der Horizontalen wie in der Vertikalen.
Steinerne Stadtlandschaften entstanden, mit zum Zentrum hin immer tiefer werdenden Straßenschluchten und einer eigenen Raumakustik, bei der sich die Schallimpulse von den Begrenzungswänden der Straßenräume vielfach brachen und reflektierten. Ein relativ hoher Grundgeräuschpegel und ein Verlust an akustischer Orientierung waren die Folgen, beides Wahrnehmungen, die bereits von den Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts gemacht wurden und die belegen, dass die Bevölkerung schon bald Erklärungen für die veränderte Akustik in der Stadt suchte.
Lärm als Inbegriff des urbanen Lebens
Die weitgereiste englische Schriftstellerin Emmy von Dincklage entwarf das treffende Bild vom schwer entrinnbaren Gefängnis, das mehr oder weniger jede Stadt in akustischer Hinsicht darstelle: „Die wild erregten Luftwellen toben und branden gegen die Hausmauern, jagen vor- und rückwärts, einen Ausweg suchend, wie die Gewässer in einem Canal und erlauben niemandem, ihnen zu entgehen, der nicht etwa in einem Luftballon in stillere Regionen aufsteigt.“
Die Stadt war „groß und laut“ geworden, das stellten immer mehr Zeitgenossen beunruhigt fest. Der „Lärm“ geriet zum Inbegriff des urbanen Lebens, zur unüberhörbaren Signatur der modernen Zeit. Wenngleich es auch früher vereinzelte Klagen über Belästigung durch Lärm gegeben hatte, so wurde er nun zu einem beinahe allgegenwärtigen Phänomen, das sich im Wohnalltag genauso manifestierte wie in der Arbeitswelt oder im öffentlichen Raum der Stadt.
Medizinische Fachblätter und führende Tageszeitungen brachten ausführliche Berichte über die „Lärmplage“, Ärzte und Psychiater sahen sich mit den Auswirkungen der Lärmausbreitung ebenso konfrontiert wie städtische Gesundheitsbeamte und Hygieneinspektoren, die eine deutliche Zunahme an diesbezüglichen Beschwerden registrierten.
In zahlreichen Städten der USA und später auch in Europa entstanden Lärmschutzbewegungen. In Deutschland gründete der Kulturphilosoph Theodor Lessing 1908 einen Antilärmverein, der zahlreiche Ortsgruppen betrieb. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf diese Initiativen waren unterschiedlich. Während die einen es euphorisch begrüßten, dass endlich etwas gegen die „Lärmseuche“ unternommen werde, konstatierte die Gegenseite den Anhängern der Bewegung schlichtweg übersensiblen Fanatismus, der sich dem Fortschritt der Zeit widersetze.
Die Auseinandersetzung mit dem Lärm wurde zum zentralen Bestandteil des zeitgenössischen Großstadtdiskurses, in dem sich Momente der Kultur- und Zivilisationskritik ebenso trafen wie jene des Klassenkampfes und der vielfach empfundenen Überreizung der Sinne. Eine urbane Wahrnehmungskultur bildete sich heraus, die „Ruhe“ zur sprichwörtlich ersten Bürgerpflicht erhob.
Überlaute Signalgeräusche wie das nervende Peitschenknallen, das Schreien, Klingeln und Hupen wurden eingeschränkt und schließlich verboten. Auf der Ebene der Stadtplanung wurde das Konzept der funktionalen Trennung einzelner Stadtbereiche realisiert, mit dem geräuschintensive Betriebe vom Wohnbereich getrennt und an den Stadtrand verlagert werden sollten. Als eine der wirksamsten lärmdämpfenden Maßnahmen wurde die Befestigung des Straßenuntergrundes mit sogenanntem „geräuschlosem Pflaster“ (Asphalt- bzw. Holzstöckelpflaster) vorangetrieben, anstelle des holprigen, enorm lauten Kopfsteinpflasters.
Schließlich wurden auch individuell anwendbare Schutzmittel erfunden, wie die sogleich massenhaft Verbreitung findenden Ohrenstöpsel „Antiphon“ (1885) und „Ohropax“ (1907). Doch trotz all dieser Maßnahmen, wurde eines immer deutlicher: Den Lärm konnte man bestenfalls verringern, keineswegs aber völlig ausschalten.
Es waren vor allem die Verkehrsgeräusche, die mittlerweile von vielen als „ohrenbetäubend“ erlebt wurden. Immer mehr entwickelte sich die Straße zur monofunktionalen Fahrbahn, die ausschließlich auf die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs ausgerichtet war – mit weitreichenden akustischen Folgen.
Akustische Individualisierung: der persönliche Soundtrack
Mit der seither und vor allem in der Nachkriegszeit deutlich ansteigenden Motorisierung entbrannten erneut heftige Diskussionen um die „Plage des Großstadtlärms“. Erneut entstanden europaweit Vereinigungen, die sich dem Kampf gegen den Lärm verschrieben. Die städtischen Behörden überlegten Maßnahmen für eine gezielte „Straßenentlärmung“, Gesetze und Messmethoden wurden verschärft.
Seit den 1980er-Jahren lassen sich zwei neue Trends beobachten: Zum einen entwickelt sich die Stadt immer mehr zur Entertainment-City, in der Events inszeniert werden und Urbanität exzessiv „ausgestellt“ wird. Zum anderen zeichnet sich eine extreme, vom technischen Fortschritt ermöglichte akustische Individualisierung ab. Walkman, Ipod und Handy erlauben es erstmals in der Geschichte des Hörens, sich einen persönlichen Soundtrack durch die Stadt zu legen, weitgehend abgekoppelt von der jeweiligen räumlichen Situation und den darin dominanten Geräuschen. Völlig neue Rahmenbedingungen also, die – in Verbindung mit der weiterhin rasant steigenden Mobilität – zu einer Intensivierung des Lärmdiskurses führen.
Und was können wir aus der historischen Betrachtung desselben lernen? Wohl vor allem dies, dass Lärm nicht nur technisch, sondern vor allem sozial zu betrachten ist. Stets geht es in den Debatten, damals wie heute, um mehr als nur um Dezibel und Grenzwerte. Es geht um gesellschaftliche Teilhabe, um Artikulation von Interessen, kurzum: um eine umfassende Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Umwelt in unserer Zeit. Dass dafür in zunehmendem Maß ein akustisches Bewusstsein vonnöten ist – auf kommunaler Ebene insbesondere auch bei Entscheidungsträgern, Stadt- und Raumplanern sowie Architekten – scheint evident.
Peter Payer
Der Autor
Dr. Peter Payer ist Historiker und Stadtforscher sowie Kurator im Technischen Museum Wien
Buchtipp: Welche Geräusche prägen den Alltag der Großstadt? Der Autor unseres Fachbeitrags hat am Beispiel der Stadt Wien erstmals die auditive Kultur einer europäischen Metropole der Zeit um 1900 vorgestellt. Die ungeheure Dynamik dieser Zeit veränderte nicht nur das Stadtbild nachhaltig, sie ließ auch eine neuen Hördiskurs entstehen. Die daraus entstehende Diskussion um den Lärmschutz beschäftigt die Stadtentwicklung bis heute.
„Der Klang der Großstadt. Zur Geschichte des Hörens, Wien 1850–1914“, Peter Payer, Böhlau-Verlag, Wien, 2018, 313 S., 29 Euro (ISBN 978-3-205-20561-6)