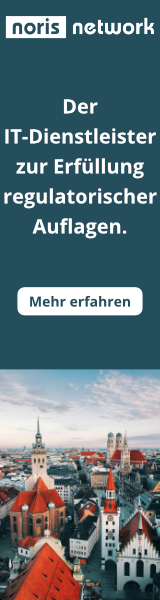Nachhaltiges Bauen ist möglich – die Branche braucht aber modifizierte Rahmenbedingungen, das streicht Verbandschef Tim-Oliver Müller heraus. Mehr noch: Es müsse unbedingt anders gebaut werden.
Wie hat sich das Thema nachhaltiges Bauen entwickelt?
Tim-Oliver Müller: Noch vor zehn Jahren war Nachhaltigkeit für das Bauen kaum ein Thema. Allein in den vergangenen zwei, drei Jahren hat sich hier aber Wesentliches getan – und tatsächlich ist der Bau eine der Schlüsselbranchen, wenn es um Klima und Nachhaltigkeit geht. Das muss sich noch sehr viel mehr im Bewusstsein von Bürgerinnen und Bürgern, von Politikerinnen und Politikern verankern: Klimaschutz kommt einem gewaltigen Bauprogramm gleich, wir müssen aber unbedingt anders bauen als wir es in den vergangenen Jahrzehnten getan haben.
Nach wie vor werden auf Baustellen aber enorm viele Ressourcen verbraucht, etwa Sand und Kies, und bei der Produktion von Baustoffen und beim Transport wird viel CO2 freigesetzt. Von einer Kreislaufwirtschaft, von einem intensiven Recyceln und Wiederverwenden sind wir weit entfernt. Warum geht es nur so langsam voran mit dem nachhaltigen Bauen?
Müller: Das lag am Auftraggeber, aber auch an der Branche. Die Tendenz war, bei dem zu bleiben, was man kannte, es kamen nur wenige Impulse für ein anderes Bauen. Das hat sich inzwischen signifikant geändert. Zum Beispiel Bauen im Bestand: Erhalt muss vor Neubau kommen – diese Einsicht hat sich längst durchgesetzt. Der Schutz von Flora und Fauna ist für die Branche ein wichtiges Thema. Ebenso die Frage, wie wir in Zeiten des Klimawandels bauen müssen, um mit zunehmender Dürre einerseits und Starkregen-ereignissen andererseits umgehen zu können. Unsere Mitglieder sind aber Auftrag-nehmer: Sie können nicht bauen, wie sie wollen, sondern sind an die Vorgaben ihrer Auftraggeber gebunden. Sprich: Auftraggeber müssen klimaschonendes Bauen einfordern und bestellen.
Was müsste sich ändern?
Müller: Sehr viel. Zum Beispiel: Es geht um Ressourceneffizienz, um CO2-Minimierung, um Resilienz im Klimawandel – das alles kostet erst einmal Geld. Solange eine Kommune gehalten ist, die vordergründig günstigste Lösung zu finden, solange Haushaltsaspekte allein ausschlaggebend sind, oder genauer: Solange die Klimafolgekosten nicht mitgedacht sind, die hohen Kosten zum Beispiel, die durch Starkregen und Überflutung verursacht werden, ist umweltschonendes Bauen schwierig. Nachhaltigkeit muss als ein zentrales Kriterium für Bauprojekte in die Ausschreibungen aufgenommen sein. Das heißt auch, dass nachhaltiges Bauen verständlich gemacht werden muss. Bürgerinnen und Bürgern muss klar sein, dass nicht nur Verkehr und andere Industriebereiche sich umstellen müssen, sondern auch der Bau – und dass das Folgen für die Kostenstrukturen hat.
Wenn Auftraggeber sich für ein nachhaltiges Bauen entscheiden – wie sieht es dann auf der Seite der Auftragnehmer aus: Sind die Voraussetzungen für nachhaltiges Bauen vorhanden?
Müller: Die technischen Lösungen sind vorhanden, unsere Mitglieder sind in der Lage, sofort anders zu bauen – auch wenn es nach wie vor Forschungsbedarf gibt, Wissenschaft ist ja immer in Bewegung. Allein stemmen können wir das aber eben nicht. Entscheidend ist, dass die Auftraggeber und ebenfalls die Lieferanten mit im Boot sind. Und wir brauchen neue Herangehensweisen. Zum Beispiel wäre es sehr wichtig, dass die Trennung von Planen und Bauen aufgehoben wird.
Wie soll das aussehen?
Müller: Bauunternehmen können sehr viel mehr als Fahrzeuge bereitstellen und Pläne abarbeiten. Sie verfügen über enorme Ingenieurskompetenzen, die es gilt, sinnvoll einzusetzen, und zwar auch und gerade im Bereich der Bauplanung. Aktuell müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen jeden einzelnen Schritt planen, müssen sich um jedes Detail kümmern – und das bei zunehmenden Personalengpässen.
Damit haben sie allerdings die Kontrolle.
Müller: Es ist aber ein enormer Aufwand und ineffizient, wenn man das für ein einzelnes Bauprojekt durchziehen muss, schlicht Ressourcenverschwendung. In einer kleinen Kommune wird im Laufe von 50 Jahren vermutlich nur ein Schulgebäude errichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich dennoch hineinknien, müssen jedes einzelne Element in Auftrag geben, von Fliesen über Waschbecken bis zum Fußboden – das sind hunderte Einzelposten und Verfahren. Dazu kommt, dass zunehmend Personal fehlt, um das abarbeiten zu können, die Risiken im Blick zu behalten und hunderte Schnittstellen zu managen. Die Unternehmen, die sich dauerhaft mit solchen Projekten befassen, können das dagegen sehr viel zügiger erledigen, können auf einen großen Erfahrungsschatz und auf ein umfangreiches Netzwerk zurückgreifen.
Welche Projektform würden Sie bevorzugen?
Müller: Aus unserer Sicht wäre es sinnvoller, wenn die Kommune nicht jedes einzelne Detail auf den Weg bringen müsste, sondern parallel zur Einzelvergabe mehr Möglichkeiten erhält, Aufträge im Ganzen zu vergeben, und „nur“ überprüfen muss, ob alle Vorgaben eingehalten sind. Aktuell muss man versuchen, bestimmte Vorgaben etwa in Form von Zertifizierungen zu erfüllen – das spornt nicht an, nachhaltiger zu bauen, als die Zertifizierung es vorgibt. Wir brauchen aber dringend Anreize, um weitere Potenziale zu heben. Die eben beschriebene, ganzheitliche Herangehensweise würde das nachhaltige Bauen fördern.
Was sollte sich also ändern?
Müller: Die Kriterien für Vergaben müssen erweitert werden: Nachhaltigkeit muss als wesentliches Kriterium hinzukommen. Kommunen sollten auch nicht gefühlte Ewigkeiten prüfen müssen, um nur ja auch beim letzten Detail keinen Formfehler zu machen. Wir brauchen nicht nur andere Strukturen, sondern ebenso eine andere Fehlerkultur, um voranzukommen. Ebenso brauchen wir andere Zulassungsverfahren für Innovationen, etwa im Baustoffbereich.
Woran machen Sie das fest?
Müller: Wenn zum Beispiel ein neuer Recycling-Beton entwickelt wird, dauert es garantiert mindestens zehn Jahre, bis er verbaut werden darf. Gefühlte Ewigkeiten dauert es auch, bis „Abfall“, also etwa Beton und Ziegel aus einem abgerissenen Gebäude, wieder als recycelte „Produkte“ anerkannt werden und wiederverwendet werden können. Hier geht es um Garantien, Haftung, Sicherheit, also um Wesentliches – dennoch: Die Vorgaben sind zum Teil überholt und verhindern die erforderliche Transformation des Bauens.
Wo setzen Sie als Verband an?
Müller: Für uns ist es zentral, unternehmerische Aspekte und Ingenieurswissen zusammenzubringen. Wir entwickeln Leitfäden mit dem Ziel, aktuelles Wissen in die Kommunen zu transportieren und zu erklären, welche Handlungsoptionen es gibt. Oder auch ganz konkret: Wir wollen Mitarbeitern in den Kommunen erklären, was eine CO2-Reduktionszahl für die Praxis heißt. Sehr wichtig: Wir suchen den Dialog und plädieren dafür, dass alle Seiten offene Ohren für das Know-how des Gegenübers haben.
Wie sieht es mit den Bürgern aus?
Müller: Das öffentliche Bewusstsein ist entscheidend. Die Zeit des Fingerzeigens auf die Politik muss allerdings vorbei sein. Wir Bürger haben die Politikerinnen und Politiker gewählt, sind also mitverantwortlich für das, was geschieht, und wir sind alle im selben Boot: Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker sowie die Baubranche – gemeinsam müssen wir Bauen neu denken. Das zu vermitteln, sehe ich aktuell als eine der zentralen Aufgaben des Verbands.
Interview: Sabine Schmidt
Zur Person: Tim-Oliver Müller ist Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e.V.