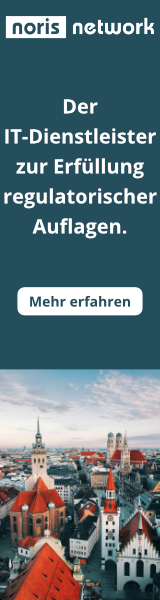Wenn es um die Sprache geht, liegen überraschend oft die Nerven blank, Fronten verhärten sich – Politik und Verwaltung müssen sich aber positionieren. Was können, was sollten sie tun, wie mit Befürwortern und Gegnerinnen des Genderns umgehen? Antworten und Empfehlungen aus der Sprachwissenschaft.
Die einen befürworten es, die anderen eben nicht, das könnte man so stehen lassen. Woran liegt es, dass Gendern oft aggressiv, auch abwertend diskutiert wird?
Carolin Müller-Spitzer: Ein wichtiger Grund scheint zu sein, dass zu wenige Menschen, die diesen Diskurs prägen, ein Interesse an einem Plädoyer für Toleranz haben. Auf der einen Seite gibt es Menschen oder Institutionen, die genderinklusive Sprache verwenden, auf der anderen Seite eine laute Bewegung, diese Sprachpraxis zu kritisieren, bis hin zu Volksinitiativen gegen das Gendern wie in Hamburg, oder Genderverboten an Sachsens und Sachsen-Anhalts Schulen.
Worum geht es hier aus Ihrer Sicht?
Müller-Spitzer: Das Ziel dieser Initiativen ist nicht, für gegenseitige Toleranz und sprachliche Freiheit einzutreten, sondern die Verwendung genderinklusiver Sprache mit Genderzeichen – wie Sternchen oder Doppelpunkt – zu untersagen, also sprachliche Vorschriften zu machen.
Welche Erfahrungen machen Sie damit?
Müller-Spitzer: Als wir am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache beispielsweise eine Pressemitteilung veröffentlicht haben, in der wir für gegenseitige Toleranz beim Thema Gendern plädieren, wurden wir teilweise kritisiert. Uns wurde vorgeworfen, dass sich das Institut zu positiv zum Thema Gendern geäußert habe. Dabei plädieren wir explizit dafür, dass wir akzeptieren sollten, mit Sprachformen konfrontiert zu werden, die nicht die sind, die wir selbst präferieren.
Warum ist das für Sie wichtig?
Müller-Spitzer: Dies ist eben eine Form von Toleranz, die man in einer pluralistischen Gesellschaft erwarten kann. Und statt sich auf den Konsens zu konzentrieren, der schon lange erreicht ist – zum Beispiel sind Doppelformen wie „Bürgerinnen und Bürger“ oder Neutralisierungen wie „Führungskräfte“ längst Teil der Sprachpraxis und weithin akzeptiert – und statt beim neu aufgekommenen Thema Genderzeichen größtmögliche Toleranz zu üben, wird das Thema immer wieder als zugespitzte Pro- und Kontra-Debatte geführt. So kann sich der Diskurs aber nicht beruhigen.
Studien geben deutliche Hinweise
Eines der Hauptargumente für das Gendern ist, dass Sprache die Wirklichkeit verändert. Wie stellt sich das aus Forschungssicht dar?
Müller-Spitzer: Dass Sprache Wirklichkeit verändert, ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Man muss sie sich eher als Denkschablone vorstellen: Wenn wir eine Personenbezeichnung lesen oder hören, denken wir an eine Person oder Personengruppe – und die Form der Personenbezeichnung kann beeinflussen, welche Art von Person vor dem inneren Auge entsteht. Das sprachliche Zeichen dient als Bedeutungshinweis.
Was bedeutet das?
Samira Ochs: Die empirische, psycholinguistische Forschung hat gezeigt, dass bei Personenbezeichnungen die Verwendung der maskulinen Form eher Männer vor dem inneren Auge entstehen lässt – auch wenn sie geschlechtsübergreifend gemeint ist. Das ist nicht für alle Wörter und für alle Kontexte gleich stark, aber es ist ein stabiler, oft replizierter Befund. Das ist für viele ein Grund, andere Formen nutzen zu wollen, zum Beispiel Doppelformen oder Formen mit Genderzeichen wie „Bürger*innen“ oder „Bürger:innen“: um deutlich zu signalisieren, dass vor dem inneren Auge Menschen aller geschlechtlichen Identitäten entstehen sollen. Dass dies mit solchen sprachlichen Formen gelingen kann, legen neue empirische Studien nahe.
Argumente gegen das Gendern lauten: Es sei zu umständlich, schlecht lesbar, für Grundschülerinnen und Grundschüler problematisch, für Menschen, die Deutsch erst lernen, zudem verhunze es die Sprache – wie sehen Sie das?
Ochs: Verben wie „verhunzen“ beschreiben einen subjektiv-ästhetischen Eindruck – Menschen haben auch bei Sprachformen unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben. Objektive Faktoren wie Verständlichkeit und Lesbarkeit wiederum kann man empirisch untersuchen, und das ist das, was uns in der Forschung interessiert. Forschungen zur Verständlichkeit genderinklusiver Sprache zeigen, dass Formen im Plural, wie „die Bürger*innen“ oder „Bürgerinnen und Bürger“, nicht die Verständlichkeit und Lesbarkeit erschweren. Anders ist das bei Konstruktionen im Singular, wie „der*die Bürger*in“.
Was heißt das für die Praxis?
Ochs: Wir müssen auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen differenzieren – ein Patentrezept gibt es nicht. Es geht insgesamt viel mehr um das Wie als um das Ob: Genderinklusive und verständliche Sprache schließen sich nicht aus, man kann beides gleichzeitig im Blick haben. Auch für die Lernbarkeit des Deutschen gibt es viel größere Hürden: Indirekte Rede, die Verwendung des Konjunktivs oder die Artikelzuordnung gelten als schwierig erlernbar. Ob Genderzeichen eine im Vergleich ebenso große Hürde darstellen, ist zweifelhaft, weil sie nicht so häufig und von der Formbildung her ziemlich einfach sind – aber es bleibt zu erforschen. Viola Noll vom Goethe-Institut sagt dazu: „Unsere Erfahrung ist: Wer unregelmäßige Verben gemeistert hat, der versteht auch schnell, was ein Gendersternchen bedeuten soll.“
Toleranz würde Sinn machen
Wenn das Gendern nun mal solch ein Ärgernis ist: Ist es dennoch so wichtig, dass man daran festhalten sollte – oder könnte man es einfach sein lassen?
Müller-Spitzer: Es müsste kein Ärgernis sein, wenn wir akzeptieren, dass wir andere nicht von unserer Position überzeugen müssen. „Leben und leben lassen“ sollte das Motto sein: Auf möglichst große sprachliche Freiheit drängen und gleichzeitig die Beweggründe der Menschen, die andere sprachliche Formen wählen als ich selbst, zu verstehen suchen. Verbote bringen uns in jedem Fall nicht weiter.
Kommunale Verwaltungen sind auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema Gendern konfrontiert. Was empfehlen Sie, was wünschen Sie sich: Wie sollten, wie könnten kommunale Akteure, Bürgermeisterinnen, Amtsleiter, Sachbearbeiterinnen mit dem Gendern umgehen?
Müller-Spitzer: Wir sehen auf Webseiten deutscher, österreichischer und schweizerischer Städte, dass viele Stadtverwaltungen dies schon sinnvoll machen. Bei Stellenanzeigen werden explizite Formen des Genderns gewählt, um eine stärkere Appellwirkung zu erzielen. Auf Webseiten etwa für „Ummeldungen“ werden eher Neutralisierungen verwendet. Insgesamt gibt es nicht die eine richtige Strategie. Wichtig wäre es, wirklich für gegenseitige Toleranz zu werben. Die Verwendung genderinklusiver Sprache ist kein Firlefanz und keine sprachliche Verirrung, auch kein sprachautoritärer Eingriff, sondern empirisch gut begründet. Aber: Man sollte ihre Verwendung trotzdem möglichst nicht vorschreiben.
Wenn man/frau gendern will – wie sollte man das tun?
Ochs: Einige Handbücher sowie die Website „genderleicht.de“ geben hervorragende Tipps zum unauffälligen Gendern. Allerdings sollte man bedenken, dass viele ihre sprachlichen Gewohnheiten nicht gern ändern und schnell Eingriffe in ihr persönliches Sprechen befürchten. Das heißt: Wenn sich kommunale Verwaltungen Richtlinien für die Verwendung bestimmter sprachlicher Formen geben, sollten sie gut begründet und verständlich sein, und es sollte innerhalb der Richtlinien so viel sprachliche Freiheit wie möglich geben, um ihre Akzeptanz zu stärken.
Was wünschen Sie sich aus der Politik?
Müller-Spitzer: Verantwortliche sollten das Thema nicht zur Polarisierung und Polemisierung nutzen und so zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, sondern aktiv die gegenseitige Toleranz stärken.
Interview: Sabine Schmidt
Zu den Personen
Prof. Dr. Carolin Müller-Spitzer ist Leiterin des Programmbereichs „Lexik empirisch und digital“ der Abteilung „Lexik“ des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache. Sie leitet das Projekt „Empirische Genderlinguistik“.
Samira Ochs ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Empirische Genderlinguisitik“ am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache.